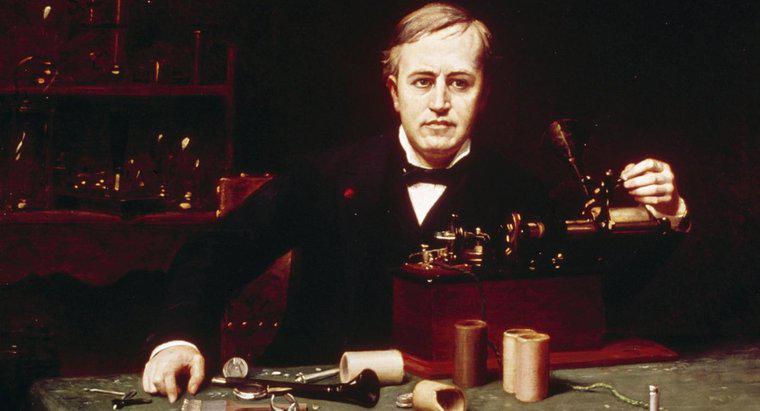Der Fall Vereinigte Staaten gegen Nixon war ein wegweisendes Gerichtsverfahren, da es feststellte, dass der Präsident der Vereinigten Staaten das Exekutivprivileg nicht als absolute Verteidigung gegen gerichtliche Untersuchungen nutzen konnte. Der Fall ereignete sich während des Watergate-Skandals, und nachdem mehrere Bänder vorgeladen wurden, behauptete Nixon, der Streit liege ausschließlich innerhalb der Exekutive. Der Oberste Gerichtshof war anderer Meinung und Nixon trat ein paar Wochen später zurück.
Die Gewaltenteilung in der US-Regierung war schon immer ein umstrittenes Thema, da sich Justiz, Legislative und Exekutive oft über die Grenzen ihrer jeweiligen Befugnisse nicht einig waren. Ein frühes Beispiel für diese Meinungsverschiedenheit war 1796, als das Repräsentantenhaus Dokumente zum Jay-Vertrag forderte, den der Senat mit Großbritannien unterzeichnete. Präsident Washington weigerte sich, diese Dokumente auszuhändigen, mit dem Argument, dass die Befugnis zum Abschluss von Verträgen ausschließlich beim Senat liege und das Repräsentantenhaus kein Recht auf die angeforderten Informationen habe.
Nixon versuchte ein ähnliches Argument, als er sein eigenes Führungsprivileg beanspruchte. Die angeforderten Aufzeichnungen enthielten Details, die für die Strafverfolgung im Watergate-Skandal relevant waren, aber der Präsident argumentierte, dass die Informationen für die Fälle der Angeklagten nicht von entscheidender Bedeutung seien und er das Privileg habe, die interne Kommunikation des Weißen Hauses zu schützen. Das Gericht entschied, dass die Annahme dieses Privilegs einer pauschalen Immunität vor gerichtlicher Überprüfung und Strafverfolgung gleichkommt und entschied einstimmig gegen Nixon.